Es geht geradezu zur Usanz in Gerichtsverfahren, dass verfahrensleitende Richter nach den Parteivorträge oder im Rahmen von Instruktionsverhandlungen eine vorläufige Einschätzung der Prozesschancen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht abgegeben. Dabei wird stets betont, dass es ich um eine vorläufige Einschätzung handelt. Insbesondere, wenn diese Einschätzung durch einen einzelnen Richter, welcher die Instruktionsverhandlung führt abgegeben wird, aber schliesslich ein Kollegialgericht zu entscheiden hat, besteht die Möglichkeit, dass das Kollegialgericht anders entscheiden wird. Auch darauf werden die Parteien in den Verfahren hingewiesen.
Befangene Richter?
Im Entscheid 4A_237/2025 vom 4. August 2025 hatte sich das Bundesgericht mit einem Fall des Aargauer Handelsgerichts zu befassen:
Der Gerichtspräsident hatte die Parteien zu einer Instruktionsverhandlung vor. Darin teilte er ihnen mit, wie er ihre Angelegenheit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht einschätze. Zugleich unterbreitete er ihnen einen bezifferten Vergleichsvorschlag. Zu Beginn der Verhandlung wies er die Parteien auf den provisorischen Charakter seiner Ausführungen hin. Im Rahmen seiner rechtlichen Würdigung sagte er unter anderem, dass in ihrem Fall die Voraussetzungen von Art. 366 Abs. 1 OR „mit Sicherheit“ erfüllt seien, und es werde diesbezüglich „in jedem Fall etwas hängen bleiben“. Als die Beklagte die Geltung von Art. 366 Abs. 1 OR bestritt, entgegnete ihr der Gerichtspräsident, dass andernfalls Art. 377 OR anwendbar sei. Die Parteien konnten sich in der Folge nicht auf eine vergleichsweise Verfahrenserledigung einigen. In der Folge stellte die Beklagte ein Ausstandsgesuch gegen den Gerichtspräsidenten wegen seiner Äusserungen an der Vergleichsverhandlung.
Gründe der Befangenheit
Nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch darauf, dass ihre Streitsache von einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Gericht beurteilt wird. Es soll garantiert werden, dass keine sachfremden Umstände, die ausserhalb des Prozesses liegen, in sachwidriger Weise zugunsten oder zulasten einer Partei auf das gerichtliche Urteil einwirken. Art. 30 Abs. 1 BV soll zu der für einen korrekten und fairen Prozess erforderlichen Offenheit des Verfahrens im Einzelfall beitragen und damit ein gerechtes Urteil ermöglichen (BGE 147 III 89 E. 4.1; 144 I 159 E. 4.3; 142 III 732 E. 4.2.2). Die Garantie des verfassungsmässigen Gerichts wird bereits verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Voreingenommenheit und Befangenheit in diesem Sinne werden nach der Rechtsprechung angenommen, wenn im Einzelfall anhand aller tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände Gegebenheiten aufscheinen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Gerichts zu erwecken. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit hervorrufen. Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass die Gerichtsperson tatsächlich befangen ist (BGE 147 III 89 E. 4.1; 142 III 732 E. 4.2.2; 140 III 221 E. 4.1).
Nach Art. 47 ZPO (Zivilprozessordnung) hat eine Gerichtsperson tritt in den Ausstand zu treten, wenn sie aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte, insbesondere wenn sie:
- in der Sache ein persönliches Interesse hat;
- in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeiständin oder Rechtsbeistand, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, als Mediatorin oder Mediator in der gleichen Sache tätig war;
- mit einer Partei, ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist oder war, in eingetragener Partnerschaft lebt oder lebte oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
- mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
- mit der Vertreterin oder dem Vertreter einer Partei oder mit einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;
- aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung, befangen sein könnte.
Beurteilung durch das Bundesgericht
Das Bundesgericht verneinte die Befangenheit. Dies aus den folgenden Gründen:
Die ZPO räume dem Gericht explizit die Befugnis ein, den Streit auf dem Vergleichsweg zu erledigen. Nach Art. 124 Abs. 3 ZPO könne das Gericht jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Dazu schlage es ihnen in der Regel an einer Instruktions- (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder an der Hauptverhandlung (Art. 228 ZPO) eine einvernehmliche Verfahrenserledigung vor Bei einem Kollegialgericht führt häufig eine Delegation die Vergleichsverhandlung durch. In einer handelsgerichtlichen Streitigkeit könne eine solche Delegation aus dem Instruktionsrichter, einem Fachrichter und dem Gerichtsschreiber bestehen.
Insbesondere in handelsgerichtlichen Streitigkeiten sei eine vergleichsweise Verfahrenserledigung von grosser Bedeutung. Handelsgerichte wollten als Fachgerichte den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechend eine rasche und kompetente Behandlung solcher Streitigkeiten sicherstellen.
Für das Verfahren vor Schlichtungsbehörden sehe Art. 205 Abs. 1 ZPO vor, dass die darin gemachten Ausführungen weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden dürfen (Art. 205 Abs. 1 ZPO). Diese Regel gälten sinngemäss auch für gerichtliche Vergleichsverhandlungen. Entsprechend seien nach einem Scheitern der Vergleichsverhandlung weder die Gerichtsmitglieder noch die Parteien an ihre dort gemachten Ausführungen gebunden. Für solche Aussagen würde grundsätzlich ein Verwertungsverbot gelten. Ihre Berücksichtigung liesse sich mit dem provisorischen und vertraulichen Charakter der Vergleichsverhandlung nicht vereinbaren. Demzufolge könne eine Partei nach dem Scheitern der Vergleichsverhandlung dem Gericht nicht vorwerfen, seine rechtliche Beurteilung im Urteil weiche von der früheren Einschätzung in der Vergleichsverhandlung ab.
Die in einer Vergleichsverhandlung durch die Gerichtsdelegation vorgenommene Einschätzung der Rechts- und Sachlage würde der Orientierung der Parteien über Prozessrisiken, Kostenfolgen und Beweisschwierigkeiten dienen. Diese Einschätzung sei vorläufig und würde für sich allein keinen Anschein der Befangenheit und somit keinen Ausstandsgrund begründen:
6.2.5. Das prozessleitende Mitglied des Einzelgerichts oder bei einem Kollegialgericht die Angehörigen der Delegation – für beide Fälle wird nachstehend der Begriff Gerichtsdelegation verwendet – verfügen über einen Spielraum, wie sie eine Vergleichsverhandlung ausgestalten möchten. In der Regel nimmt die Gerichtsdelegation zu Beginn eine Einschätzung des vorhandenen Prozessstoffes vor: Anhand der Akten ermittelt sie den massgebenden Sachverhalt und wendet darauf die einschlägigen Rechtsnormen an. Anschliessend zeigt sie den Parteien auf, ob und wenn ja, in welchem Umfang die eingeklagten Ansprüche aus ihrer Sicht bestehen. Neben Hinweisen auf allfällige Beweisschwierigkeiten erfolgen häufig auch Ausführungen zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie zur Verfahrensdauer im Entscheidfall (vgl. BRUNNER, Kunst des Vergleichs, a.a.O., S. 85 f.; SCHMID, Dos & Don’ts, a.a.O., S. 47; KAUFMANN/KAUFMANN, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Bd. I, 3. Aufl. 2025, N. 61 zu Art. 124 ZPO). Anmerkungen zu ausser- oder nachprozessualen Aspekten, wie Vollstreckungsschwierigkeiten, sind ebenfalls zulässig.
Nach dieser Einschätzung wird die Gerichtsdelegation, wenn angezeigt, die Verhandlung unterbrechen, damit die Parteien sie mit ihren Anwälten besprechen können (HOCHSTRASSER/JAISLI KULL, Die Vergleichsverhandlung aus Sicht des Anwalts, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, Rz. 16.67). Danach finden die eigentlichen Vergleichsgespräche statt, während derer die Parteien sich zu den gerichtlichen Ausführungen äussern und gegebenenfalls eigene Vorschläge machen können (vgl. MARTINA SCHMID CHRISTOFFEL, Gerichtliche Vergleichsverhandlung – eine praxisorientierte Wegleitung, Justice – Justiz – Giustizia 1/2011 Rz. 25).
6.2.6. Je nach Beurteilung der Prozesschancen kann die Gerichtsdelegation den Parteien einen ganzen oder teilweisen Klagerückzug, eine entsprechende Klageanerkennung oder einen bezifferten Vergleich vorschlagen. Eine solche vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage begründet für sich allein keinen Anschein der Befangenheit. Dies gilt auch dann, wenn sie zum Nachteil einer Partei ausfällt (vgl. Urteile 5A_608/2024 vom 29. Januar 2025 E. 5.3.2; 4A_265/2024 vom 22. Juli 2024 E. 2.3.2).
6.2.7. Je bestimmter und überzeugender die Gerichtsdelegation während der Vergleichsverhandlung argumentiert, umso eher werden die Parteien ihrem Vorschlag zustimmen (vgl. ROGER WEBER, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 124 ZPO; JENNY/ABEGG, in: ZPO, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 124 ZPO). Gleichzeitig wird von ihr aber auch erwartet, dass sie ihre Einschätzung der Prozesschancen zurückhaltend äussert und die förmliche Streitentscheidung vorbehält (BGE 146 I 30 E. 2.4; 134 I 238 E. 2.4 S. 244; FRANÇOIS BOHNET, in: CPC augmenté, 2025, N. 11 zu Art. 124 ZPO). Dies gilt besonders, wenn zwischen den Parteien eine Asymmetrie besteht, etwa, weil bloss eine Seite anwaltlich vertreten ist. Zwischen dem Anliegen der Gerichtsdelegation, die Parteien von ihrem Vorschlag zu überzeugen, und der gebotenen Zurückhaltung besteht ein Spannungsverhältnis (vgl. PLATZ, a.a.O., S. 295). Entsprechend stellen Vergleichsverhandlungen hohe Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeiten der Gerichtsdelegation (SCHMID, Vergleichsverhandlungen vor dem Handelsgericht, a.a.O., S. 259).
Sodann ist für das Bundesgericht unproblematisch, dass die Richter, welche die unpräjudizielle Ansicht kundgetan haben, beim Scheitern der Vergleichsgespräche am Entscheid mitwirken:
6.2.8. Wenn zwischen den Parteien keine Einigung zustande kommt, muss das Gericht ein Urteil fällen, an dem auch die Gerichtsdelegation mitwirkt: Je nach funktioneller Zuständigkeit entscheidet der Instruktionsrichter, der zuvor die Vergleichsverhandlung geleitet hat, entweder als Einzelrichter oder er stellt als Referent einen Entscheidantrag zuhanden des Kollegialgerichts. Auch die weiteren Personen aus der Gerichtsdelegation, namentlich der Fachrichter, wirken an dieser nunmehr autoritativen Verfahrenserledigung mit. Anders als eine Schlichtungsbehörde oder ein privater Mediator können sich die Angehörigen der Gerichtsdelegation somit nicht auf das reine Vermitteln beschränken. Entsprechend dürfen sie bei Scheitern der Vergleichshandlung nicht ihr Amt niederlegen. Vielmehr wechseln sie dann ihre Rolle von der schlichtenden zurück zur rechtsprechenden Person (vgl. KÖLZ, a.a.O., S. 231). Um den Parteien diesen möglichen späteren Rollenwechsel bewusst zu machen, muss die Gerichtsdelegation sie auf den vorläufigen und unpräjudiziellen Charakter ihrer Einschätzung hinweisen (vgl. SCHMID CHRISTOFFEL, a.a.O., Rz. 30). Dies gilt besonders bei prozessunerfahrenen Parteien. Dazu braucht sie aber nicht jede einzelne ihrer Aussagen zu relativieren. Es genügt, wenn die Parteien erkennen können, dass die Gerichtsdelegation ihren Rechtsstreit bloss vorläufig und gestützt auf den bestehenden, unvollständigen Aktenstand würdigt. Auch hat sie gegebenenfalls festzuhalten, dass die weiteren Mitglieder der Kollegialbesetzung möglicherweise zu einem anderen Schluss kommen könnten.
Die Gerichtsdelegation muss den Parteien ihre tatsächliche und rechtliche Einschätzung verständlich erklären und sich mit allfälligen Einwänden auseinandersetzen. Je nach Zusammensetzung der Gerichtsdelegation kommt ihren Angehörigen eine unterschiedliche Rolle zu: Ein Fachrichter kann beispielsweise dank seiner Branchenerfahrung komplexe Sachverhaltsfragen würdigen und nicht evidente Zusammenhänge aufzeigen. Der Instruktionsrichter wird sich primär zum einschlägigen Sach- und Verfahrensrecht äussern. Gegebenenfalls macht auch der Gerichtsschreiber ergänzende Ausführungen. Durch diese multiperspektivische Einschätzung der Prozesschancen gewinnt der gerichtliche Vergleichsvorschlag bei den Parteien an Überzeugungskraft (SCHMID, Vergleichsverhandlungen vor dem Handelsgericht, a.a.O., S. 254-256).
Fehlen der Delegation die nötigen Informationen und trifft sie deshalb in ihrem Vorschlag Annahmen oder bestehen Unsicherheiten bzw. Risiken, hat sie dies gegenüber den Parteien offenzulegen (SCHMID CHRISTOFFEL, a.a.O., Rz. 30). Während einer Vergleichsverhandlung können neue relevante Umstände bekannt werden. Entsprechend darf die Gerichtsdelegation keine voreiligen Schlüsse treffen, sondern muss sich eine Offenheit des Denkens bewahren (BRUNNER, Kunst des Vergleichs, a.a.O., S. 72 und 76).
6.2.9. Im Gegensatz zu aussergerichtlichen Vergleichsgesprächen nimmt die Gerichtsdelegation bei gerichtlichen Vergleichsbemühungen eine aktive Rolle ein. Sie leitet die Gespräche, hört den Parteien zu, unterbreitet ihnen Lösungsansätze und führt sie zu einer einvernehmlichen Einigung (BRUNNER, Kunst des Vergleichs, a.a.O., S. 77 f.).
6.2.10. Die Parteien und die Gerichtsdelegation arbeiten in einer Vergleichsverhandlung folglich informeller und stärker zusammen als dies in einer kontradiktorischen Hauptverhandlung der Fall ist, wo das Gericht vielfach bloss die Parteivorträge entgegennimmt. Sie erörtern zusammen frei den Sachverhalt. Gegebenenfalls kann die Gerichtsdelegation in diesem Rahmen über den Streitgegenstand hinaus auch nach den allfälligen wirklichen Gründen ihres Streites forschen (BRUNNER, Kunst des Vergleichs, a.a.O., S. 79 und 81). Diesem informellen Zusammenwirken ist bei der Beurteilung der Befangenheit Rechnung zu tragen. Aus einzelnen missverständlichen oder ungeschickten Äusserungen der Gerichtsdelegation darf nicht unbesehen auf eine Befangenheit geschlossen werden (vgl. BGE 127 I 196 E. 2d; 116 Ia 14 E. 6). Die Parteien dürfen hier – wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat – nicht jedes einzelne Wort der Gerichtsdelegation auf die Goldwaage legen. Ob ein Mitglied der Gerichtsdelegation wegen Äusserungen an einer Vergleichsverhandlung befangen erscheint, muss vielmehr aufgrund einer Gesamtbetrachtung entschieden werden. Zu prüfen ist, ob seine Äusserungen oder sein Verhalten insgesamt Zweifel an seiner Unparteilichkeit wecken. Solches ist beispielsweise dann der Fall, wenn es sich abschätzig über eine Partei auslässt oder ihre Argumente und Beweismittel konsequent ignoriert. Unzulässig wäre es auch, eine Partei oder deren Vertretung vor der anderen blosszustellen (vgl. PETER NOBEL, Vergleichsverhandlungen in der Praxis [Teil 2], SJZ 117/2021 S. 205). Vielmehr darf sich die Gerichtsdelegation weder Sympathien noch Antipathien anmerken lassen. Sie muss auch „schwierigen“ Parteien mit Respekt begegnen. Dabei hat sich ein sachliches Vorgehen als vergleichsfördernde Massnahme bewährt (SCHMID CHRISTOFFEL, a.a.O., Rz. 29).
6.2.11. Eine Vergleichsverhandlung zielt auf eine einvernehmliche Streitbeilegung ab (E. 6.2.2). Bezweckt wird die konsensuale anstatt die autoritative Verfahrenserledigung durch Entscheid (KÖLZ, a.a.O., S. 231). Entsprechend erlaubt die gerichtliche Einschätzung der Prozesschancen in einer Vergleichsverhandlung für sich alleine nur sehr beschränkt Rückschlüsse auf eine Befangenheit. Hat sich die Gerichtsdelegation sorgfältig auf die Vergleichsverhandlung vorbereitet, wird sie von ihrer Einschätzung regelmässig überzeugter sein, als wenn sie die Verfahrensakten vorgängig nur überflogen hat. Um Fehlanreize zu vermeiden, darf aus einem hohen Überzeugungsgrad der Gerichtsdelegation nicht unbesehen auf ihre fehlende Entscheidoffenheit im Falle einer strittigen Fortführung des Verfahrens geschlossen werden. Die Parteien haben zudem ein legitimes Interesse, in der Vergleichsverhandlung die wirkliche Einschätzung der Gerichtsdelegation zu erfahren (SPÜHLER/BOLLINGER-BÄR/THALER, Der gerichtliche Vergleich, 2. Aufl. 2025, S. 32; SCHMID, Vergleichsverhandlungen vor dem Handelsgericht, a.a.O., S. 258). Nur so können sie gestützt auf die Sicht dieser neutralen Drittperson abschätzen, ob sie den Prozess strittig weiterführen wollen. Folglich braucht die Gerichtsdelegation ihre Überzeugung nicht hinter einem Schleier von Vorbehalten zu verbergen, nur weil sie ansonsten befürchten müsste, von der unzufriedenen Seite als befangen abgelehnt zu werden (ähnlich NOBEL, a.a.O., S. 203 sowie JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, N. 9 zu Art. 124 ZPO, wonach die Gerichtsdelegation den Parteien ihren Eindruck vom Stand des Prozesses unter Vorbehalt der bloss vorläufigen Einschätzung „klar und eindringlich“ vermitteln dürfe).
6.2.12. Richterliche Verfahrensfehler stellen nur ausnahmsweise die Unbefangenheit einer Gerichtsperson in Frage. Es müssen objektiv gerechtfertigte Gründe zur Annahme bestehen, dass sich in den Rechtsfehlern gleichzeitig eine Haltung manifestiert, die auf fehlender Distanz und Neutralität beruht. Mithin müssen besonders krasse Fehler oder wiederholte Irrtümer vorliegen, die eine schwere Verletzung der Richterpflichten darstellen (BGE 143 IV 69 E. 3.2; 138 IV 142 E. 2.3). So kann sich ein Ausstandsgrund auch aufgrund einer Gesamtwürdigung ungewöhnlich häufiger Fehlleistungen der Verfahrensleitung ergeben (Urteil 5A_85/2021 vom 26. März 2021 E. 3.2). Das Ausstandsverfahren ist mithin nicht dazu da, um einen vermeintlichen oder tatsächlichen Rechtsanwendungsfehler zu korrigieren (BGE 138 IV 142 E. 2.3; 116 Ia 135 E. 3a; 115 Ia 400 E. 3b). Dies muss bei einer Vergleichsverhandlung umso mehr gelten, als die Gerichtsdelegation hier keine abschliessende, sondern bloss eine vorläufige, unpräjudizielle Einschätzung vornimmt.
Weitere Beiträge zu prozessualen Fragen:
- Übersetzung fremdsprachiger Beweismittel im Arbeitsprozess?
- Neue prozessuale Fristenfalle
- Keine strafprozessualen Garantien bei internen Untersuchungen
- Prozessvertretung durch Gewerkschaften
- Glaubhaftmachung in Gleichstellungsprozessen
- Geplante Änderung der Zivilprozessordnung – Auswirkungen auf den Arbeitsprozess
- Örtlich zuständiges Gericht beim Arbeitsprozess
- Einsprache gegen die Kündigung (Art. 336b OR) und Novenschranke
- Schadenersatz wegen Mobbing und soziale Untersuchungsmaxime
- Arbeitsrecht – soziale Untersuchungsmaxime (Art. 247 Abs. 2 ZPO)
Autor: Nicolas Facincani
Weitere umfassende Informationen zum Arbeitsrecht finden Sie hier.

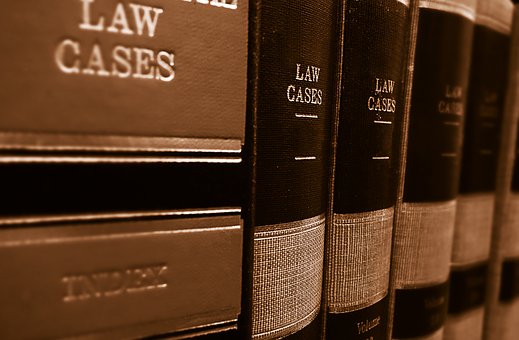
Das Bundesgericht verneint Befangenheit gewohnheitsmässig. Ausnahmen sind sehr selten. Der Handelsgerichtspräsident hat sich natürlich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Er schadet damit dem von ihm angestrebten Vergleich.