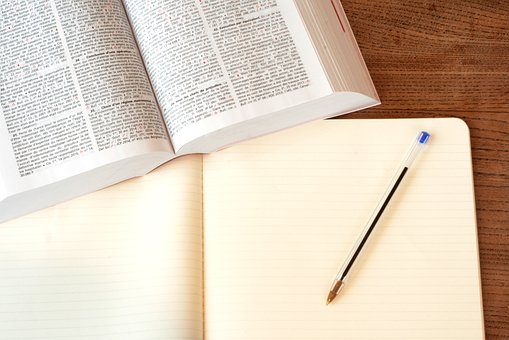Das Bundesgericht wies im Entscheid 4A_681/2024 vom 15. August 2025 die Beschwerde eines Arbeitnehmers ab, worin es die von den Parteien vereinbarte «jederzeitige Kündigungsfrist von 30 Tagen» als nichtig erachtete und bestätigte die vorinstanzliche Auffassung, dass nach Art. 335c Abs. 2 OR in solchen Fällen die gesetzliche Mindestfrist von einem Monat greift. Im Weiteren beantragte der Arbeitnehmer einen Bonus, welcher ihm aber verwehrt blieb, da weder aus den eingereichten Unterlagen noch aus den Zeugenaussagen ein solcher Anspruch ersichtlich war.
Dem Entscheid lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Sachverhalt
A (nachfolgend: Arbeitnehmer) wurde am 1. März 2018 von der B. SA (nachfolgend: Arbeitgeberin) angestellt. Dabei war ein Bruttojahreslohn von Fr. 104‘000.00 vorgesehen sowie die Gewährung eines Bonus «bis zu einem Höchstbetrag von 10 % […] des Bruttogehalts pro Jahr bei Erreichen der Ziele.» Der Vertrag sah weiter vor, dass beide Parteien «zu jedem Datum eines Monats mit einer Frist von 30 Tagen» kündigen konnten.
Am 14. Juli 2020 kündigte die Arbeitgeberin den Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ordentlich per 31. August 2020. Am 23. Juli 2020 kündigte sie ihm erneut zum gleichen Datum. Am 29. Juli 2020 stellte die Arbeitgeberin den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist frei.
Der Arbeitnehmer klagte daraufhin auf Zahlung von Fr. 19‘735.80. Die setzten sich wie folgt zusammen:
- Lohn inkl. anteilmässiger 13. Monatslohn in der Höhe von Fr. 8’666.65 bis zum ordentlichen Ablauf der Kündigungsfrist im September 2020;
- Bonus in der Höhe von Fr. 7’280;
- Fr. 1’389.14 für Spesen;
- Fr. 2’400.00 für die Miete seiner Bar.
Der Pretore di Lugano verurteilte die Arbeitgeberin zur Zahlung von Fr. 19’776.15 brutto (Fr. 17’333.30 für Löhne und den entsprechenden Anteil des 13. Monatsgehalts bis Oktober 2020 und Fr. 2’402.50 brutto für den Bonus 2020) zuzüglich Zinsen und verpflichtete sie zudem, dem Kläger 3’500 Franken für wiederkehrende Kosten zu erstatten.
In Abänderung des erstinstanzlichen Urteils verurteilte das Kantonsgericht Tessin die Arbeitgeberin in der Berufung zur Zahlung von brutto Fr. 8’666.65 zzgl. Zinsen. Das Kantonsgericht vertrat die Auffassung, dass anstelle der von den Parteien vereinbarten unzulässigen Kündigungsfrist von 30 Tagen, konkret eine Frist von einem Monat anwendbar (Art. 20 Abs. 2 OR) war. Die Wirkungen der Kündigung war somit auf den 30. September 2020 zu übertragen, und die Arbeitgeberin musste auch für diesen Monat den Lohn zahlen. Die Bonusforderung wurde hingegen abgewiesen, da der Kläger diesen Anspruch auch im Falle einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses nicht geltend gemacht oder nachgewiesen hatte und da es keine Beweise für ein Zugeständnis der Arbeitgeberin hinsichtlich der Verpflichtung zur Zahlung eines Bonus an den Kläger im Jahr 2020 gab.
Der Arbeitnehmer wandte sich an das Bundesgericht und beantragte im Wesentlichen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Verurteilung der Arbeitgeberin zur Zahlung von Fr. 19’776.15 zuzüglich Zinsen.
Mindestkündigungsfrist
Art. 335c OR regelt die Kündigungsfristen und -termine für das unbefristete Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit (Staehelin, ZK OR 335c N 1). Die Kündigungsfrist soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor zu rascher Beendigung des Arbeitsvertrages schützen. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist im ersten Dienstjahr einen Monat, vom zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr zwei Monate und ab dem zehnten Dienstjahr drei Monate.
Die gesetzlichen Kündigungsfristen können durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag verlängert oder verkürzt werden. Die Kündigungsfrist muss mindestens einen Monat (Minimalfrist) betragen. Eine Verkürzung der gesetzlichen Kündigungsfrist unter einen Monat oder die Wegbedingung einer Kündigungsfrist (entfristete Kündigung) ist nur für das erste Dienstjahr und nur durch GAV möglich.
Entscheid des Kantonsgerichts
Für das Kantonsgericht bedeutete die Vereinbarung der Parteien über eine kürzere Kündigungsfrist als die in Art. 335c Abs. 1 OR vorgesehene Frist nicht konkret, dass diese anstelle der rechtswidrig vereinbarten Frist anzuwenden war. In einem solchen Fall sei die in Art. 335c Abs. 2 OR vorgesehene Mindestkündigungsfrist von einem Monat anzuwenden (mit Verweis auf BGE 47 II 295 E. 2). Hätten die Parteien nämlich von der Nichtigkeit der von ihnen vereinbarten Kündigungsfrist von 30 Tagen gewusst, weil diese zu kurz war, hätten sie sich in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR für eine Frist von einem Monat entschieden, die der kürzesten zulässigen Frist entspricht.
Entscheid des Bundesgericht
Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die sehr klare Absicht einer allgemeinen Kündigungsfrist von 30 Tagen, nicht gesetzeskonform ist, womit sich die Frage nach dem subsidiären Willen der Parteien stellte: «In concreto, l’intenzione delle parti, seppur chiara, è contraria alla legge in quanto contrattualmente era stato concordato un termine generale di preavviso della disdetta di 30 giorni, ossia inferiore a un mese. Si pone pertanto la questione a sapere se, nella fattispecie, le parti avessero una volontà sussidiaria o se la norma di legge dispositiva sostituisca il patto contrattuale previsto, ma inammissibile.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 3.2.2).
Dabei machte das Bundesgericht zunächst allgemeine Ausführungen wie der subsidiäre Wille zu ermitteln ist: Diese Frage ist unter Anwendung des Vertrauensprinzips zu klären, indem die mutmassliche oder hypothetische Absicht der Parteien festgestellt wird, sofern nicht ein tatsächlicher Wille der Parteien in dieser Hinsicht nachgewiesen werden kann (BGE 131 III 467 E. 1.2; Urteil 4A_257/2020 vom 18. November 2020 E. 3.3). Das Gericht muss versuchen zu ermitteln, was die Parteien unter den konkreten Umständen in gutem Glauben vereinbart hätten, wenn sie von dem Mangel gewusst hätten (Urteil 4A_257/2020, E. 3.3).
Im konkreten Fall, trat das Bundesgericht auf das Vorbringen des Arbeitnehmers nicht ein, da er nicht aufzuzeigen vermochte, warum die Schlussfolgerung des Kantonsgerichts – wonach die Parteien, wenn sie von dem Mangel gewusst hätten, sich für eine Kündigungsfrist von einem Monat entschieden hätten, die ihrem vertraglichen Willen gemäss dem Gesetz am ehesten entsprochen hätte – falsch sein soll: «l ricorrente, infatti, non spiega perché la conclusione dei giudici ticinesi secondo cui le parti, se fossero state a conoscenza del vizio, avrebbero optato per un preavviso di disdetta di un mese, ossia quello più fedele alla loro volontà contrattuale secondo la legge, sia errata.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 3.3). Diese Schlussfolgerung wurde in Wahrheit als haltbar und rechtskonform angesehen: «Al riguardo il rimedio è infruttuoso.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 3.3).
Bonus
Der Arbeitnehmer beanstandet vor Bundesgericht die Verweigerung des Bonus. Er brachte vor, dass das Kantonsgericht den Sachverhalt unrichtig festgestellt und zu Unrecht geschlossen hat, dass sich der Richter auf das Schreiben vom 26. November 2020 gestützt habe. Gemäss diesem sei – nach Auffassung des Arbeitnehmers – der Bonus als Gratifikation zu qualifizieren, zumal er den Bonus 2018 (obwohl er nicht das ganze Jahr gearbeitet habe) und 2019 ebenfalls erhalten habe. Im Schreiben vom 26. November 2020 sei nicht erwähnt worden, dass der Bonus aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht gezahlt worden sei; daher bestehe auch einen Anspruch.
Nach Ansicht des Bundesgerichts ging der Arbeitnehmer auf diese Argumente nicht ausreichend ein. Insbesondere widerlegt er weder die Kritik des Kantonsgerichts, er habe trotz der Beendigung des Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf den Bonus geltend gemacht, noch deren Feststellung, dass aus dem Schreiben vom 26. November 2020 kein Eingeständnis einer Verpflichtung der Gegenpartei zur Zahlung des Bonus für dieses Jahr an den Arbeitnehmer hervorgeht: «Egli, in particolare, non confuta la critica a lui mossa dai giudici cantonali di non aver allegato l’esistenza di un diritto al bonus nonostante l’interruzione del rapporto di lavoro, né il loro accertamento secondo cui dallo scritto del 26 novembre 2020 non era desumibile un’ammissione di un obbligo dell’opponente di pagare al dipendente il bonus per quell’anno.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.2.2). Unter diesen Umständen reichen die Aussagen des Arbeitnehmers zum Erhalt von Boni in den Jahren 2018 und 2019 nicht aus, um das angefochtene Urteil zu widerlegen: «In condizioni del genere, le dichiarazioni del ricorrente concernenti l’ottenimento di bonus nel 2018 e nel 2019 non bastano a inficiare il giudizio impugnato.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.2.2).
Willkürliche MBO-Bewertung
Der Arbeitnehmer brachte weiter vor, dass die Feststellungen betreffend der in der MBO-Bewertung genannten Ziele des Kantonsgerichts willkürlich seien. Insbesondere habe die Arbeitgeberin gegen Treu und Glauben verstossen, da sich diese der Herausgabe der Unternehmensbuchhaltung widersetzt habe. Sinngemäss bestritt der Arbeitnehmer somit, dass die Erreichung der Ziele des Arbeitnehmers als nicht beweisen angesehen werden dürften.
Mit diesem Argument vermochte der Arbeitnehmer ebenfalls nicht durchzudringen. Einerseits wurde dieses Argument (Verstoss gegen Treu und Glauben) vor Kantonsgericht nicht vorgebracht, womit sich eine diesbezügliche Prüfung mangels Erschöpfung der kantonalen Rechtsmittel der Kognition des Bundesgerichts entzieht: «Intanto, non consta che l’insorgente abbia biasimato l’opponente di aver agito in modo contrario alla buona fede processuale già davanti alla Corte di appello; tale critica sfugge dunque a un esame del Tribunale federale a causa del mancato esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.3). Andererseits erläutert der Arbeitnehmer nicht, welche negativen Auswirkungen die verspätete Vorlage von Dokumenten durch die Arbeitgeberin für ihn hatte, auch nicht im Hinblick auf die Bewertung des Dokuments N. Diesbezüglich ist das Kantonsgericht nicht in Willkür verfallen, wenn dem Dokument N die Beweiskraft abgesprochen wurde, indem es feststellte, dass Unklarheit betreffend dessen Glaubwürdigkeit bestehe: «In secondo luogo, il ricorrente non illustra gli effetti negativi a lui cagionati dalla tardiva produzione di documenti ad opera dell’opponente, e ciò anche con riferimento alla valutazione del doc. N. Come evidenziato dai giudici cantonali, poi, in concreto il Pretore stesso aveva accertato, con riferimento alle valutazione di cui ai doc. N e 7, che „sulla fedefacenza dei dati riportati nell’uno o dell’altro documento“ vi era „ancora poca chiarezza“, e che „vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita“ (sentenza impugnata, consid. 8.1.2). La Corte cantonale poteva così negare senza arbitrio forza probatoria al doc. N» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.3).
Willkürliche Sachverhaltsfeststellung
Im Weiteren beanstandet der Arbeitnehmer, dass die Feststellung des Kantonsgerichts betreffend den Gewinn der Arbeitgeberin willkürlich erfolgt sei. Der Arbeitnehmer brachte vor Bundesgericht vor, dass konkret aus dem Revisionsbericht ein Umsatzrückgang von 5% für das Jahr 2020 hervorgegangen sei, die Tätigkeit der Arbeitgeberin jedoch bereits Ende Juli 2020 eingestellt worden sei. In der Bilanz würden sich für 2020 hohe Kosten für den Einkauf von Produkten (Fr. 1’868’539.00) ergeben, die höher sind als 2019 (Fr. 1’500’437.00), sowie eine Finanzierung der Tochtergesellschaft (D. AG) in Höhe von $ 100’000.00 im Jahr 2020. Zum 31. Dezember 2020 würde somit ein Bilanzgewinn von Fr. 554’735.00 ausgewiesen. Die Finanzierung der Tochtergesellschaft sei unlauter, da sie eine ihrer Beteiligungsgesellschaften finanziert und trotz der Entscheidung zur Schliessung der Niederlassung im Tessin die Einkaufsvolumina für Produkte im Jahr 2020 nicht reduziert habe.
Diese Argumentation schlug vor Bundesgericht ebenfalls fehl, da der Arbeitnehmer diese Argumente erst vor Bundesgericht vorbrachte und damit – sinngemäss – eine Erweiterung bzw. Vervollständigung des Sachverhalts beantragt. Da keine Anhaltspunkte für Willkür bestehen und dies sodann eine Abweichung des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts darstellen würde, zielt der Arbeitnehmer mit seinem Vorbringen ins Leere: «Ora, laddove afferma che l’attività dell’opponente sarebbe terminata già a fine luglio 2020, che i costi di acquisto di prodotti per il 2020 sarebbero stati maggiori rispetto a quelli del 2019, e che al 31 dicembre 2020 vi sarebbe stato un utile di bilancio di fr. 554’735.–, il ricorrente si propone di completare la fattispecie senza spiegare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato tali fatti alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura. Non è dunque possibile scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.4.1).
Letztlich brachte der Arbeitnehmer vor, dass von ihm keine detaillierte Aufführung der in seinem „MBO” enthaltenen Zahlen verlangt werden könnte, da die Bewertung und Hochrechnung der Daten in die Zuständigkeit des Arbeitgebers und der jeweiligen Verantwortlichen fallen. Das Unternehmen verfüge über alle erforderlichen Informationen und Zahlen. Er habe das Bestehen des Bonusanspruchs (Arbeitsvertrag), seinen Anspruch auf 70 % desselben (Dok. N), die positive Entwicklung des Unternehmens (bestätigt durch die Zeugen E., F. und G.), die Aufforderung zur Herausgabe der Buchhaltung des Beklagten für 2020 zum Nachweis der Umsätze und die Erklärungen des Zeugen F. nachgewiesen.
Das Bundesgericht kam hierbei zum Schluss, dass der Nachweis des Bonusanspruchs (Arbeitsvertrag), die Forderung nach Offenlegung der Buchhaltung des Beklagten für das Jahr 2020 zum Nachweis der Verkäufe und die Erklärungen des Zeugen F. nicht ausreichend sind, um die Bonusforderung des Klägers anzuerkennen. Er macht geltend, dass er seinen Anspruch auf den Bonus in Höhe von 70 % (Dok. N) und die positive Entwicklung des Unternehmens (bestätigt durch drei Zeugen) dokumentiert habe, was aber vom Kantonsgericht widerlegt wurde. Auch die Zeugenaussagen waren nicht hilfreich, da sie durch andere Beweise widerlegt wurden, ebenso wenig wie die in der Bilanz ausgewiesenen Verkaufsergebnisse, da nicht bekannt ist, welcher Verkäufer in welchem Umfang zu deren Erzielung beigetragen hat. Die Beschwerde wurde daher auch in diesem Punkt abgewiesen: «Ciò premesso, in concreto la prova dell’esistenza del diritto al bonus (contratto di lavoro), la richiesta di edizione della contabilità dell’opponente per il 2020 a comprova delle vendite e le spiegazioni del teste F. non sono sufficienti per riconoscere la pretesa del ricorrente. Egli fa valere di aver documentato il suo diritto al bonus nella misura del 70 % (doc. N) e il positivo andamento della società (confermato da tre testimoni), ma tali fatti sono stati smentiti dalla Corte di appello. Non sono d’aiuto neanche le dichiarazione di Rolf F., in quanto contraddette da altre prove, né i risultati di vendita registrati nel bilancio, ignorandosi quale venditore abbia contribuito al loro raggiungimento e in che misura. Il rimedio, dunque, è infruttuoso.» (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_681/2024 vom 15. August 2025, E. 4.6).
Weitere Beiträge zur Kündigung (Auswahl):
- Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Vertrag mit Mindestdauer – Kündigung
- Die Kündigungsparität
- „Die E-Mail gilt als Kündigung“
- Kündigung per SMS, WhatsApp, E-Mail
- Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses
- Gekündigt und ab zum Arzt
- Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
- Der Zeitpunkt der Zustellung einer Kündigung
- E-Mail Kündigung während den Ferien – Zeitpunkt?
- Entlassung altershalber
- Fehlender sachlicher Kündigungsgrund macht Kündigung nicht nichtig
- Der sachliche Kündigungsgrund bei öffentlichen Dienstverhältnissen
- Abfindung und Entschädigung nach Kündigung eines öffentlichen Dienstverhältnisses
- Mobbing im öffentlichen Dienstverhältnis
- Falsche Zeiterfassung – Schwerwiegende Verletzung der Treuepflicht
- Falsche Begründung der Kündigung ist keine Urkundenfälschung
- Kündigung erfordert Urteilsfähigkeit
Autoren: Nicolas Facincani / Matteo Ritzinger
Weitere umfassende Informationen zum Arbeitsrecht finden Sie hier.