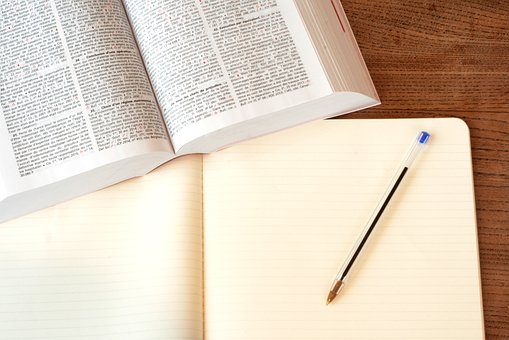Das Arbeitszeugnis hat eine Doppelfunktion, welche zwei unterschiedliche Bedürfnisse bedient. Es soll einerseits das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers fördern und andererseits zukünftigen Arbeitgeberinnen ein möglichst genaues Abbild von den Fähigkeiten und der Persönlichkeit des Arbeitnehmers geben. Aus diesem doppelten Zweck lassen sich einige Grundsätze ableiten, an welchen sich das Arbeitszeugnis inhaltlich zu orientieren hat. Das Zeugnis hat mithin insbesondere dem Grundsatz der Wahrheit, sowie den Grundsätzen der Klarheit und der Vollständigkeit zu entsprechen. Der Grundsatz des Wohlwollens hat zum Zweck, das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers zu fördern, oder dieses zumindest nicht unnötigerweise zu erschweren.
Zeugnishoheit beim Arbeitgeber
Wie aus dem Entscheid des Bundesgerichts 1C_400/2024 vom 23. April 2025 einmal mehr hervorgeht, kommt dem Arbeitgeber bei der Ausstellung eines Arbeitszeugnisses aber ein breites Ermessen zu. Grundsätzlich sind Formulierung und Wortwahl des Arbeitszeugnisses der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber überlassen. Der Arbeitnehmende hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Formulierung. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber ist daher nicht verpflichtet, vom Arbeitnehmenden gewünschte Formulierungen zu übernehmen (BGE 144 II 345 E. 5.2.3 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Es besteht sodann kein Anspruch, ein gutes Zeugnis in ein sehr gutes Zeugnis umformulieren zu lassen, es sei denn, die arbeitnehmende Person vermag ihre überdurchschnittlichen Leistungen nachzuweisen (vgl. Urteil 4A_117/2007, 4A_127/2007 vom 13. September 2007 E. 7.1).
Verlangte Zeugnisänderungen
Ein Thurgauer Staatsanwalt verlangte im Rahmen einer subsidiären Verfassungsbeschwerde (der Streitwert für die Beschwerde in Zivilsachen war nicht erreicht) die nachfolgenden Zeugnisänderungen:
„Er möchte das Zeugnis um einen Absatz ergänzt haben, wonach er im Zusammenhang mit der Rekrutierung, Einarbeitung und Qualifizierung einer ausserordentlichen Staatsanwältin erste Führungserfahrungen habe sammeln können (Berichtigungsantrag 1). Sodann verlangt er verschiedene Umformulierungen im Arbeitszeugnis: „Fundierte“ Fachkenntnisse sollen durch „sehr gute“, eventualiter „äusserst fundierte und breite juristische Kenntnisse“ ersetzt werden mit der Ergänzung, dass er dieses Wissen nicht nur „gekonnt“, sondern „gekonnt und erfolgreich“ bei der täglichen Arbeit eingesetzt habe (Berichtigungsantrag 2). Dass er sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht „stets gute Endprodukte“ geliefert habe, soll durch „jederzeit hochwertige und fehlerfreie Endprodukte“, eventualiter „sehr gute und fehlerfreie“, subeventualiter „stets gute bis sehr gute Endprodukte“ ersetzt werden (Berichtigungsantrag 3). In persönlicher Hinsicht soll ihm ebenfalls ein „sehr gutes“ und nicht nur ein „gutes“ Zeugnis ausgestellt werden (Berichtigungsantrag 4).“
Mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde kann ausschliesslich die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 116 BGG). Das Bundesgericht prüft die Verletzung von Grundrechten nicht von Amtes wegen, sondern nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG). Dies bedeutet, dass klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen. Die Prüfung des Bundesgerichts ist somit eingeschränkt.
Das Begehren des Thurgauer Staatsanwaltes wurde abgelehnt, mit der folgenden Begründung:
Erster Berichtigungsantrag
6.2. Wie die Vorinstanz gestützt auf die jährlichen Leistungsbeurteilungen schlüssig dargelegt hat, hat der Beschwerdeführer keine überdurchschnittliche Leistung nachweisen können, weshalb er auch keinen Anspruch hat, das bereits gute Zeugnis in ein sehr gutes umformulieren zu lassen. Daran vermögen auch die weitschweifigen Einwände des Beschwerdeführers im bundesgerichtlichen Verfahren nichts zu ändern; das Bundesgericht prüft seine Rügen (u.a. Verletzung der Zeugnisgrundsätze) im Verfahren der subsidiären Verfassungsbeschwerde nur auf Willkür oder andere Verfassungsverletzungen hin (vgl. E. 2.1 hiervor).
Die Vorinstanz hat sich bei ihrer Beurteilung berechtigterweise auf die jährlichen Leistungsbeurteilungen („Zielvereinbarung/Beurteilung/Förderung“ [ZBF]) abgestützt. Wie bereits dargelegt (E. 4.1 hiervor), trifft es entgegen dem Beschwerdeführer gerade nicht zu, dass die Vorinstanz der Leistungsbeurteilung des letzten, zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zuständigen Vorgesetzten und dessen Ermessen ohne sachliche Gründe absoluten Vorrang eingeräumt hätte. Weshalb sie nicht auch auf dessen Leistungsbeurteilungen in den Jahren 2018 bis 2020 hätte abstellen dürfen, wird vom Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich dargelegt. Er kann sich mit Blick auf das Willkürverbot nicht mit dem Einwand begnügen, er habe zu diesem Vorgesetzten kein gutes Verhältnis gepflegt. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, hat sich der Beschwerdeführer nur bei der ZBF des Jahres 2020 in Bezug auf das Fachwissen und Fachkönnen gegen die „B“-Bewertung des damaligen Vorgesetzten gewehrt. Gegen die übrigen „B“-Bewertungen hat er nicht opponiert.
Dass das auf den jährlichen ZBF beruhende Arbeitszeugnis nicht der Wahrheit entsprechen soll oder nicht wohlwollend oder unvollständig sein soll, ist nicht hinreichend dargelegt; ein diesbezüglicher Verstoss gegen das Willkürverbot ist jedenfalls nicht erkennbar. Dies ist in Bezug auf die einzelnen Berichtigungsbegehren nachfolgend kurz aufzuzeigen.
Zweiter Berichtigungsantrag
6.2.1. Hinsichtlich des zweiten Berichtigungsantrags („sehr gute“ anstatt „fundierte“ Fachkenntnisse, eventualiter „äusserst fundierte und breite juristische Kenntnisse“) scheint der Beschwerdeführer dem Zwischenzeugnis ein höheres Gewicht beimessen zu wollen als der von der Vorinstanz vorgenommenen Gesamtschau der Jahresbeurteilungen, denen insgesamt drei „B“-Beurteilungen (Anforderungen erfüllt) und drei „A“-Beurteilungen (Anforderungen übertroffen) zugrunde lagen. Selbst wenn die Formulierung „sehr gut“ als leicht bessere Qualifizierung als „fundiert“ verstanden werden kann, ist es jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz unter Berücksichtigung der drei „B“-Bewertungen (am Schluss des Arbeitsverhältnisses) und drei „A“-Bewertungen des früheren Vorgesetzten zum Schluss gekommen ist, es bestünden keine objektivierbaren Nachweise dafür, dass ihm eine Qualifizierung seines Fachwissens bzw. Fachkönnens mit „sehr gut“ zustünde. Mit seinen Ausführungen vermag der Beschwerdeführer jedenfalls kein überdurchschnittliches Fachwissen bzw. -können nachzuweisen.
Es ist dem Beschwerdeführer zwar einzuräumen, dass die Vorinstanz keine Ausführungen zur beantragten Berichtigung, „gekonnt“ durch „gekonnt und erfolgreich“ zu ersetzen, gemacht hat. Allerdings ist dies wohl darauf zurückzuführen, dass er diesen Antrag in seiner Beschwerde vor der Vorinstanz selber auch nicht begründet hat. Jedenfalls dringt der Beschwerdeführer auch hier mit seiner Gehörs- und Willkürrüge nicht durch, zumal die vorinstanzliche Begründung (implizit) auch diesen Eventualantrag abdeckt. Dasselbe gilt für die von ihm gerügte Verletzung der Begründungspflicht, dass sich die Vorinstanz nicht explizit zum Eventualantrag „äusserst fundierte und breite juristische Kenntnisse“ geäussert habe.
Dritter Berichtigungsantrag
6.2.2. Zum dritten Berichtigungsantrag ([er lieferte sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht] „jederzeit hochwertige und fehlerfreie Endprodukte“, eventualiter „sehr gute und fehlerfreie“, subeventualiter „stets gute bis sehr gute Endprodukte“, anstatt „stets gute Endprodukte“) hielt die Vorinstanz fest, zwar seien die ZBF-Bewertungen während der gesamten Anstellungsdauer für Arbeitsqualität und Arbeitsquantität nur in den letzten drei Jahren 2018 bis 2020 (und dies auch nur teilweise) mit „B“ bewertet worden. Dies stehe mit der Einschätzung der Personalrekurskommission in Widerspruch, dass in den ZBF mehr „B“-Bewertungen als „A“-Bewertungen vorlägen. Dieser Umstand allein würde aber höchstens eine Änderung im Sinne des Subeventualantrages („stets gute bis sehr gute Endprodukte“) rechtfertigen. Zu berücksichtigen sei aber auch das vom Vorgesetzten verortete sprachliche Verbesserungspotential (Anwendung der heute geltenden Rechtschreibregeln und der verschiedenen Dimensionen der Textverständlichkeit, Einfachheit und Kürze/Prägnanz beim schriftlichen Ausdruck), das relativ grundlegende Punkte betreffe und einer Gesamtbewertung in der vom Beschwerdeführer in Haupt- sowie auch Eventual- und Subeventualantrag gewünschten Formulierung entgegenstünde.
Es ist nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz auch den Umstand mitberücksichtigt hat, dass in der ZBF 2019 ein sprachlicher Verbesserungsbedarf festgestellt worden ist. Der Beschwerdeführer vermag nicht nachvollziehbar darzutun und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb dieser Umstand in der Gesamtbewertung keine Relevanz haben und den Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Richtigkeit verletzen sollte. Dass auch der sprachliche Ausdruck im Zusammenhang mit der vom Beschwerdeführer verlangten Berichtigung („jederzeit hochwertige und fehlerfreie Endprodukte“) vom Bedeutung ist, leuchtet ein. Wenn die Vorinstanzen in einer Gesamtwürdigung die vom Beschwerdeführer abgelieferten Endprodukte deshalb als „gut“ bewerteten, ist dies jedenfalls unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden.
Vierter Berichtigungsantrag
6.2.3. Schliesslich halten die vorinstanzlichen Erwägungen auch hinsichtlich des vierten Berichtigungsantrags („sehr gutes“ anstatt „gutes“ persönliches Zeugnis) vor dem Willkürverbot stand. Der Beschwerdeführer vermag nicht aufzuzeigen, dass die Vorinstanz auch bei seiner Verhaltensbeurteilung nicht die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses berücksichtigt hätte. Entgegen seinem Einwand hat die Vorinstanz weder das Zwischenzeugnis vom 31. Mai 2018 völlig ausgeblendet noch das Kriterium der Teamfähigkeit willkürlich zu stark berücksichtigt.
Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, ist die Teamfähigkeit des Beschwerdeführers in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mit „B“ bewertet und auch seine Kritikfähigkeit in den Jahren 2019 und 2020 als verbesserungsbedürftig bezeichnet worden. Auch wenn die Beurteilungen in persönlicher Hinsicht im Zwischenzeugnis und in den Beurteilungen des früheren Vorgesetzten besser ausgefallen sind, erscheint es jedenfalls nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz aufgrund des in den letzten Jahren festgestellten Verbesserungspotentials nicht beanstandet hat, dass die Generalstaatsanwaltschaft das persönliche Verhalten bei einer Gesamtwürdigung immerhin – wohl unter Berücksichtigung der letzten Jahre – noch als „gut“ bewertet hat.
Weitere relevante Beiträge zu Arbeitszeugnissen
- Unterzeichnung von Arbeitszeugnissen
- Sind Krankheiten im Arbeitszeugnis zu erwähnen?
- Erwähnung längerer Absenzen im Arbeitszeugnis
- Rückgabeanspruch des Arbeitgebers auf das Arbeitszeugnis
- Vorgehen bei einer Zeugnisklage – Erfüllungsklage
- Verjährung von Arbeitszeugnissen
- Haftung für ein falsches Arbeitszeugnis
- Die Arbeitsbetätigung
- Referenzen im Arbeitsrecht
- Zeugnisinhalt: Verhalten gegenüber Kunden, Mitarbeitenden und Vorgesetzten
- Erstellung von Arbeitszeugnissen
- Wir bedauern das Ausscheiden
- Zulässigkeit von Arbeitszeugnissen mit Schulnoten
- Arbeitszeugnisse
- Der Streitwert des Arbeitszeugnisses
- Krankheiten und negative Äusserungen im Arbeitszeugnis
- Hinweis zu den Umständen des Austritts im Arbeitszeugnis
- Möglichkeiten bei einer Zeugnisklage
- Zeitpunkt der Ausstellung des Arbeitszeugnisses
- Das Arbeitszeugnis 2.0 – Das Arbeitszeugnis der Zukunft
- Das Enddatum im Arbeitszeugnis
- Die Adresse des Zeugnisempfängers
- Vollstreckung eines Vergleichs vor Schlichtungsbehörde zum Arbeitszeugnis
- Wahrheit und Klarheit im Arbeitszeugnis
- Unterschrift im Arbeitszeugnis – Unterzeichnung mit qualifizierter elektronischer Signatur?
- Wohlwollendes Zeugnis um jeden Preis?
- Nennung Covid-Fehlverhalten im Arbeitszeugnis?
Autor: Nicolas Facincani
Weitere umfassende Informationen zum Arbeitsrecht finden Sie hier.